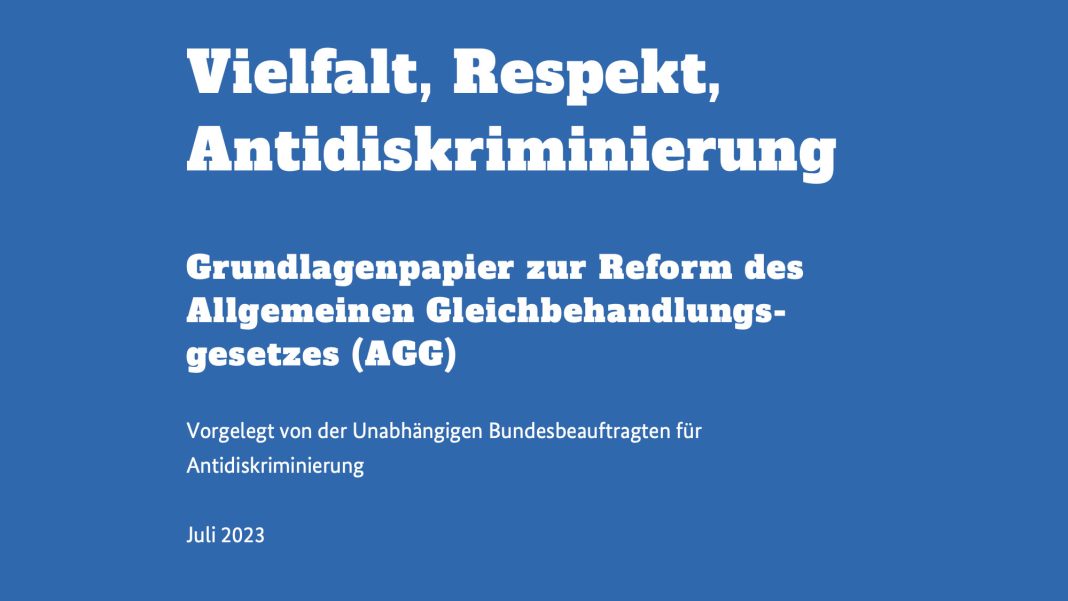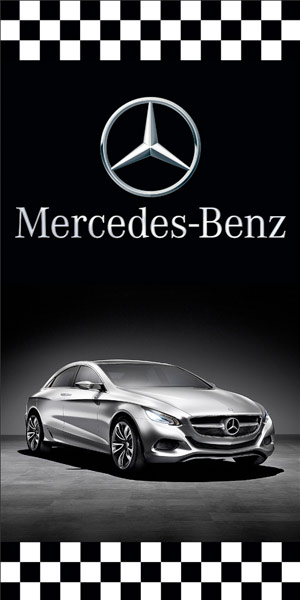Antidiskriminierungsbeauftragte demontiert den Rechtsstaat
Eine neue juristische Schnapsidee
Die Politik zerstört mit immer neuen Ideen den Rechtsstaat
STRAFRECHTSJOURNAL schickt voraus, dass wir politisch neutral sind. Die folgende Abhandlung ist kein politisches Statement. Allerdings sollte die Politik generell gewarnt sein, aus Effekthascherei den Rechtsstaat über Bord zu werfen. Dies gilt für rechte wie für linke rechtswidrige Ideologien. Die Bürger wünschen sich generell authentische Politik, die Probleme realistisch anpackt und keine polemischen Kampagnen.
Gut gemeint ist nicht gut gemacht
Die von den Grünen eingesetzte Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Ferda Ataman (43) möchte das Antidiskriminierungsgesetz reformieren. Dabei sägt sie mit ihren Ideen an den Grundrechten des Deutschen Staates.
Ferda Ataman ist seit Juli 2022 Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung und Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Quelle: antidiskriminierungstelle.de).

QUELLE:STEFFEN KUGLER / BUNDESPRESSEAMT
Die studierte Politologin war mehrere Jahre im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration in Nordrhein-Westfalen und als Referatsleiterin in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes tätig. Darüber hinaus arbeitete sie als Buchautorin, Journalistin und Kolumnistin, unter anderem für den Spiegel, den Tagesspiegel und den Rundfunk Berlin-Brandenburg und baute den Mediendienst Integration auf, eine wissenschaftliche Informationsplattform für Journalist*innen. Zuletzt gründete sie ein Beratungsunternehmen für Diversität. Parallel engagierte sich Ataman ehrenamtlich in Vereinen für mehr Vielfalt in Medien und eine gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft und war Mitglied im Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Die Unabhängige Bundesbeauftragte wird auf Vorschlag der Bunderegierung vom Deutschen Bundestag für fünf Jahre gewählt. Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung ist bei allen Vorhaben, die ihre Aufgaben berühren, zu beteiligen. Sie kann der Bundesregierung Vorschläge machen und Stellungnahmen zuleiten. In den Fällen, in denen sich eine Person wegen einer Benachteiligung an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt hat und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstrebt, kann die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis erklärt.
Alle Bundesministerien, sonstigen Bundesbehörden und öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind verpflichtet, die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung bei der Erfüllung der Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. (Quelle: antidiskriminierungstelle.de)
Das Grundlagenpapier zur „Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes“ (AGG) vom Juli 2023 ist auf der Homepage der Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung (antidiskriminierungsstelle.de) veröffentlicht und steht dort als pdf zum download bereit. Das AGG ist seit 2006 in Kraft. Es regelt den Schutz vor „Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion und Weltanschauung, einer Behinderung, des Alter oder der sexuellen Identität.“
STRAFRECHTSJOURNAL unterstützt jede Form einer Arbeit gegen Diskriminierung.
Daher ist die Grundidee des AGG und auch die Idee einer Bundesbeauftragten grundsätzlich eine gute Idee und eine Notwendigkeit. Allerdings darf man auf der anderen Seite nicht über das Ziel hinaus schiessen, sonst wird aus einer gut gemeinten Antidiskriminierungsinitiative das Gegenteil: Eine Demontage des Rechtsstaats.
Das AGG wurde bisher nicht novelliert. 2016 wurde es evaluiert. Die Untersuchung ergab Nachbesserungsbedarf in juristischer als auch hinsichtlich der praktischen Durchsetzbarkeit der Regelungen (Quelle: antidiskriminierungsstelle.de).
Das Grundlagenpapier zur „Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes“ (AGG) vom Juli 2023 enthält verschiedene Abschnitte zu verschiedenen Themen. Dabei bezieht es sich leider mehr oder weniger ausschliesslich auf das AGG selbst und lässt andere Rechtsnormen ausser Betracht, so dass die Rechtslage nicht vollständig wieder gegeben wird.
In den Kapiteln 15., 16., 17. und 18. werden allerdings Vorschläge unterbreitet, die den Rechtsstaat – bei entsprechender Umsetzung im AGG – demontieren würden.
Auszug aus dem Grundlagenpapier:
- Nachweis von Diskriminierung erleichtern
Zentrale Herausforderung bei der Durchsetzung von Rechten nach dem AGG ist die Be- weislastverteilung. Das AGG sieht zwar eine Beweislasterleichterung vor, jedoch ist diese nicht ausreichend. Die Betroffenen müssen Indizien dafür darlegen, dass die nach- teilige Behandlung auf einem geschützten Merkmal beruht. Solche Indizien sind ohne die Angabe von Gründen, die zur Bewerbungsabsage oder zur Ablehnung des Vertrags- schlusses führen, oft kaum zu erbringen. Aktuell muss das Vorliegen der Benachteiligung ebenso wie das Vorliegen der Indizien vollumfänglich bewiesen werden.
Das Erfordernis, eine Benachteiligung und Indizien nachzuweisen, sollte auf die Glaubhaftmachung herabgesenkt werden, das heißt, dass die überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt. Es sollte ein Auskunftsanspruch gegenüber der diskriminierenden Partei geschaffen werden. In § 22 AGG sollten als Regelbeispiele festgeschrieben werden, dass zum Beispiel die Aussagen der betroffenen Personen, Testings oder auch das Versäumnis eines Arbeitgebers, eine Beschwerdestelle einzurichten, hinreichende Indizien darstellen können.
- Entschädigungen wirksam und abschreckend gestalten
Die europarechtlichen Vorgaben sehen ausdrücklich vor, dass Sanktionen bei Diskrimi- nierung wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen. Das betrifft insbe- sondere die Entschädigungshöhe. Diese fällt in der Rechtspraxis aber oft mit ein paar Hundert Euro niedrig aus. Auch ist in der Rechtsprechung teilweise eine Tendenz er- kennbar, dass in Bezug auf die Diskriminierung eine Mindestschwere gefordert wird, um einen Entschädigungsanspruch auszulösen. Eine solche „Bagatellgrenze“ widerspricht dem Wortlaut sowie Sinn und Zweck des AGG.
Es sollte in § 15 beziehungsweise § 21 AGG klarstellend aufgenommen werden, dass Sanktionen bei Diskriminierung wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen.
www.antidiskriminierungsstelle.de
- Betroffene entlasten – Verbandsklagerecht einführen
Betroffene von Diskriminierung schrecken oft vor der Geltendmachung ihrer Rechte zu- rück. Dies liegt daran, dass ein Gerichtsverfahren langwierig ist und mit unüberschauba- ren Kosten und Risiken einhergeht. Erschwerend kommt hinzu, dass mangels gefestigter Rechtsprechung in großen Teilen des Antidiskriminierungsrechts die Erfolgsaussichten einer Klage kaum zu bewerten sind. Das führt dazu, dass der Diskriminierungsschutz ein Wirksamkeitsdefizit aufweist.
Ein Verbandsklagerecht sowie die Möglichkeit der Prozessstandschaft wirken dem ent- gegen. Ersteres ermöglicht qualifizierten Antidiskriminierungsverbänden, in Fällen struktureller Diskriminierung ohne individuelle Betroffenheit zu klagen und dadurch Grundsatzrechtsprechung zu schaffen, um Betroffenen Rechtssicherheit bei einer eigenen Klage zu geben. Letzteres ermöglicht den Verbänden, individuelle Rechte für Betroffene geltend zu machen, um diese zu entlasten.
Es sollten ein Verbandsklagerecht sowie die Möglichkeit der Prozessstandschaft für Antidiskriminierungsverbände geschaffen werden.
- Rechtssicherheit schaffen – altruistisches Klagerecht einrichten
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes beziehungsweise die Unabhängige Bundesbe- auftragte für Antidiskriminierung ist im europäischen Vergleich mit wenig Kompetenzen ausgestattet. Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die Kompetenzen der Antidiskrimi- nierungsstelle des Bundes als nationale Gleichbehandlungsstelle in Deutschland zu stärken. Ziel sollte dabei sein, europäischen Standards zu entsprechen. Hilfreich wäre in diesem Sinn ein altruistisches Klagerecht für die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskrimi- nierung. Es dient nicht der Durchsetzung individueller Interessen einzelner Personen, son- dern wird in Fällen genutzt, in denen es keine Kläger*innen gibt. Ein altruistisches Klage- recht dient der Schaffung von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im Antidiskriminie- rungsrecht.
Diese Vorschläge verletzten die Grundsätze des Rechtsstaats
Zu 15) Beweiserleichterung
Eine Glaubhaftmachung darf für ein staatliches Verfahren nicht ausreichen, wo eine Person eine andere Person einer Straftat beschuldigt. Es gilt für jede Person eine Unschuldsvermutung, die nicht dadurch ausgehöhlt werden darf, dass eine andere Person diesen Menschen beschuldigen darf, ohne dass Beweise erhoben werden müssen. So können schnell zahllose Opfer von Verleumdungen entstehen. Der vermeintliche Opferschutz schiesst über das Ziel hinaus und würde zu vielen neuen Opfern führen.
Zu 16) Entschädigungen abschreckend gestalten
Die Idee, dass eine Entschädigung abschreckend wirken soll, entbehrt jeder Grundlage. Eine Entschädigung ist eine zivilrechtliche Kompensationsleistung für einen erlittenen Schaden und soll keine Strafwirkung haben. Wir kennen – anders als in den USA – einen Strafschadensersatz nicht. Aus guten Gründen sollten wir diesen auch nicht durch die Hintertür einführen.
Zu 17) Verbandsklagerecht
Die Idee ein Verbandsklagerecht einzuführen kann sinnvoll sein. Hierbei sind jedoch genaue rechtsstaatliche Verfahren und Voraussetzungen zu statuieren.
Zu 18) Altruistisches Klagerecht der Bundesbeauftragten
Die Idee eines altruistischen Klagerechts klingt wie die Statuierung einer Monarchie für eine Bundesbeauftragte, die für sich Sonderrechte einführen möchte. Diese Idee ist völlig absurd und in keinerlei Hinsicht notwendig. Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung hätte dann ein Monopol Ihrerseits andere Person zu diskriminieren durch völlig willkürliche Eingriffe in die Freiheit von Personen. Es könnten dann willkürlich Personen durch die Bundesbeauftragte denunziert werden ohne selbst betroffen zu sein. Ein Verbandsklagerecht ist zu bevorzugen, in dessen Rahmen wenigstens ein Gremium über die Klage entscheidet – und selbst dies ist in engen Grenzen zu halten
Der Deutsche Rechtsstaat ist vielleicht das höchste Deutsche Staatsgut und genießt weltweites Ansehen. Er darf nicht aus politischem Wunschdenken geopfert werden. Die Einfallstore kommen von rechtsaußen und linksaussen sind jedoch gleichermaßen gefährlich. Der Rechtsstaat muss neutral bleiben und darf der Politik keine Sonderrechte einräumen, die die Rechtsstaatlichkeit einschränken oder teilweise beseitigen wollen.
Es ist äußerst gefährlich, Sonderrechte mit dem Zweck der Idee zu rechtfertigen. Denn der jeweils politische Gegner könnte dann versucht sein, für seine Zwecke ebenfalls Sonderrechte zu reklamieren. Dann wird die Antidiskriminierungskampagne selbst zur Diskriminierung, indem sie politische Gegner oder andere unerwünschte Personen attackiert ohne sich selbst eines rechtsstaatlichen Verfahrens zu bedienen. Der Rechtsstaat erodiert und der politische Gegner kann unter anderen mit den Mitteln des Strafrechts ohne rechtsstaatliche Verfahren ausgeschaltet werden. Wer die Mauern des Rechtsstaats einreißt wird selbst darunter leiden, weil seine Gegner es dann genauso machen.
Schreiben Sie Ihre Meinung an redaktion@strafrechtsjournal.de