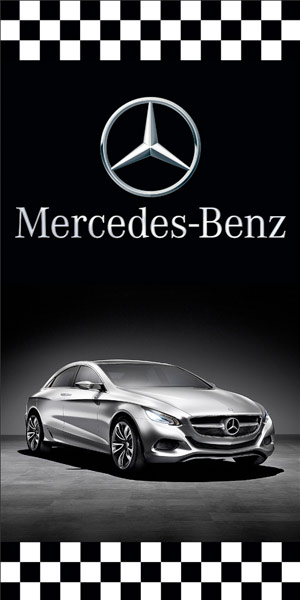Die perfekte Strafrechtshausarbeit
Wie schreibt man die perfekte Strafrechtshausarbeit
StRJ Tipps für Studenten*innen
- Aufgabe erfassen
Zunächst ist die Aufgabe genau zu erfassen. Es ist also zunächst zu fragen, was will die Prüfungsperson von mir.
- Thema: Soll ich zu einem bestimmten Thema schreiben?
- Fall: Soll ich einen konkreten Strafrechtsfall prüfen.
Obwohl es so einfach klingt, ist es das nicht immer. Fehler in dem Verständnis der Aufgabenstellung führen schnell zu einer Verfehlung des Themas oder einzelner Prüfungspunkte. Wichtig ist es, die genauen Prüfungsfragen zu beantworten und nicht ein neues Thema „aufzumachen“ nach dem Motto „Alles was ich weiss“.
- Hilfsmittel, Hinweise und Anforderungen der Prüfperson
Genau klären: Welche Hilfsmittel, Hinweise und Anforderungen hat die Prüfperson für mich, z. B. Hinweise zur Aufgabenstellung, Zitierweise, Anforderung an das Format, Prüfungsrand, Literatur, etc.
| StRJ: Die konkreten Hilfsmittel, Hinweise und Anforderungen der Prüfperson oder der jeweiligen Universität gehen den hier genannten Hinweisen immer vor! |
- Wie beginne ich rein praktisch meine Arbeit
- Rechtzeitig beginnen: Das Beste ist sofort nach der Ausgabe der Aufgabe mit der Arbeit zu beginnen und nicht erst abzuwarten bis ein Teil der Frist für die Erledigung der Aufgabe abgelaufen ist.
- Aufgabe mehrmals lesen: Als ersten Schritt sollte die Aufgabe oder der Sachverhalt mehrmals gelesen werden. Dabei empfiehlt es sich bereits Stichpunkte der ersten Gedanken zu machen.
- Erste Recherche im Internet: Nach dem vollständigen Erfassen der Aufgabe/des Sachverhalts kann bereits eine kurze Recherche zu ersten Fragen im Internet hilfreich sein.
- Online Recherche/Bibliothek Ihrer Universität: Prüfen Sie die Recherchemöglichkeiten, die Ihnen Ihre Universität zur Verfügung stellt.
- Dialog mit der Prüfungsperson: Sprechen Sie mit ihrer Prüfungsperson, soweit dies möglich ist, über ihre Arbeit; ggf. auch mehrmals während der Bearbeitung.
- Gliederung erstellen: Eine erste Gliederung der eigenen Arbeit sollte so früh wie möglich – zunächst provisorisch – erfolgen. Später kann dann anhand der Gliederung eine detaillierte Bearbeitung erfolgen und die Gliederung kann stetig verbessert werden.
- Text erstellen: Nachdem die Gliederung soweit detailliert erscheint, dass der Text anhand der Gliederung bearbeitet werden kann, sollte mit dem Schreiben frühzeitig begonnen werden. Dabei ist es sinnvoll, zu jedem Gliederungspunkt/Prüfungspunkt zunächst die wichtigsten Textquellen zu lesen und erst danach mit dem Schreiben zu beginnen.
- Fertigstellung: Es ist sehr sinnvoll, die Arbeit so früh wie möglich einmal durchzuschreiben um den „roten Faden“ zu bekommen um danach einzelne Passagen weiter mit Literatur und Rechtsprechung auszubauen. Bei diesem Vorgehen gibt es auch gegen Ende der Bearbeitungsfrist die wenigsten Probleme mit der Zeit.
- Korrektur lesen: Nach der Fertigstellung der Arbeit ist es gut sie einen Tag liegen zu lassen und sie erst am nächsten Tag final selbst Korrektur zu lesen. Im Anschluss daran sollte man die Arbeit einer anderen Person zum Korrekturlesen geben. In der Regel ist man selbst etwas „betriebsblind“ und entdeckt nicht mehr alle Fehler.
- Aufbau einer Hausarbeit
Dies ist in der Regel der Aufbau einer Hausarbeit:
- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis/Gliederung
- Text
- Literaturverzeichnis
- Eigenständigkeitserklärung
Ein Abkürzungsverzeichnis ist regelmäßig nicht erforderlich.
- Inhaltsverzeichnis/Gliederung
Jede Arbeit beginnt mit einem sorgfältig ausgearbeiteten Inhaltsverzeichnis. Dabei sollte jeder Gliederungspunkt eine Nummerierung erhalten. Die Gliederung muss in sich logisch sein. Der Aufbau muss klar sein.
Es gibt im Wesentlichen zwei Gliederungsarten. Dabei ist zu beachten, dass es einen Gliederungspunkt nur dann geben kann, wenn es von der gleichen Gliederungsebene mindestens zwei Punkte gibt. Also z. B. I. kann es nur geben, wenn es auch II. gibt, etc.
Die alphanumerische Gliederung
- Gliederungsebene 1
- Gliederungsebene 2
- Gliederungsebene 3
- a) Gliederungsebene 4
- aa) Gliederungsebene 5
- bb) Gliederungsebene 5
(1) Gliederungsebene 6
(2) Gliederungsebene 6
- b) Gliederungsebene 4
- Gliederungsebene 2
- Gliederungsebene 1
Die dezimale Gliederung
- Gliederungsebene 1
1.1 Gliederungsebene 2
1.1.1 Gliederungsebene 3
1.1.2 Gliederungsebene 3
1.2 Gliederungsebene 2
- Gliederungsebene 1
Um weitere Gliederungsebenen zu erhalten, können Sie zum Beispiel auch „Kapitel“ einführen oder „Teile“.
Beispiel:
1. Teil: Alte Rechtslage
1. Kapitel: Thema 1
1. Gliederungsebene 1
1.1 Gliederungsebene 2
1.1.1 Gliederungsebene 3
1.1.2 Gliederungsebene 3
1.2 Gliederungsebene 2
2. Gliederungsebene 1
2. Kapitel: Thema 2
(dann wieder jeweils mit den Unterpunkten)
2. Teil: Aktuelle Rechtslage
(dann wieder jeweils mit den Unterpunkten)
(dann wieder jeweils mit den Unterpunkten)
- Teil: Aktuelle Rechtslage
(dann wieder jeweils mit den Unterpunkten)
Inhaltlich gibt es immer mindestens 3 Teile.
- Einleitung/Grundlagen
- Hauptteil
- Fazit
Die Einleitung soll stringent in ein Thema einführen, die Aufgabenstellung kurz umreißen und ggf. Hinweise zum Gang der Arbeit enthalten. Dabei sollte die Einleitung bereits das Interesse des Lesers/Prüfungsperson wecken. Von umfangreichen Ausschweifungen ist abzusehen. Die Einleitung sollte so kurz wie möglich gehalten werden und 10 % der Arbeit nicht überschreiten.
In dem Hauptteil ist das eigentliche Thema detailliert, umfangreich und sorgfältig gegliedert darzustellen. Der Hauptteil muss auch rein vom Seitenumfang her mindestens 80 % der Arbeit darstellen. Inhaltlich gliedern Sie nach bestimmten strafrechtlichen Paragraphen, z. B. des Strafgesetzbuches. Denken Sie daran, dass es nach der Darstellung der einzelnen strafrechtlichen Paragraphen immer einen Punkt geben muss, der sich mit den strafrechtlichen Konkurrenzen bei Tateinheit auseinandersetzen muss. Sollte es sich um eine Fallbearbeitung handeln muss ggf. auch zur Tatmehrheit ausgeführt werden.
Das Fazit sollte 10 % der Arbeit nicht überschreiten. Trotz der gebotenen Kürze sollte das Fazit gut formuliert und durchdacht sein. In der universitären Praxis ist leider zu beobachten, daß das Fazit nur noch „hintendran geklatscht“ wird und sprachlich wie inhaltlich stark abfällt.
Gliedern Sie in der Gliederung/Inhaltsverzeichnis so tief wie möglich. Sinnvoll ist auch ganz am Ende Ihrer Bearbeitung in das Inhaltsverzeichnis Seitenzahlen einzuarbeiten, so dass die Prüfungsperson zu einem bestimmten Punkt die richtige Seite aufschlagen kann.
| Machen Sie es der Prüfungsperson durch Übersichtlichkeit Ihrer Gliederung so leicht wie möglich, Ihre Arbeit schnell zu verstehen. |
Jeder Gliederungspunkt sollte eine eigene kurze Überschrift haben – möglichst nur ein Wort.
Beispiel einer „gemischten“ Gliederung:
- Teil: Einleitung
- Teil: Strafbarkeit
I. § 263 StGB
- Objektiver Tatbestand
1.1 Täuschung über Tatsachen
1.2 Irrtum
1.3 Vermögensverfügung
1.4 Kausalität
2. Subjektiver Tatbestand
3. Rechtswidrigkeit
4. Schuld
- § 266 StGB
III. Konkurrenzen
- Teil: Sinnvolle Gesetzesnovellen
- Teil: Fazit
- Literaturverzeichnis/Zitieren
Das Literaturverzeichnis ist detailliert und alphabetisch zu erstellen.
Es ist stets die aktuelle Literatur zu verwenden, es sei denn es ist die Rechtslage zu einem längst vergangenen Zeitpunkt zu betrachten, z. B. NS Verbrechen.
Dabei sind im Strafrecht immer die Standardwerke zu zitieren. Von unbekannten Internetquellen ist Abstand zu nehmen. Ein Literaturverzeichnis einer Hausarbeit sollte über 20 Bücher zitieren können.
Im Literaturverzeichnis heißt es dann z. B.:
Eisenberg, Ulrich, Beweisrecht der StPO, 10. Auflage, 2017
Fischer, Thomas, Kommentar Strafgesetzbuch, 69. Auflage, 2022
Lackner/Kühl, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 30. Auflage, 2023
Meyer-Goßner/Schmitt, Kommentar Strafprozessordnung, 65. Auflage, 2022
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band I, §§ 1 – 37, 4. Auflage, 2020
Schäfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumesssung, 6. Auflage, 2017
Schönke/Schröder, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 30. Auflage, 2019
Wessels/Beulke/Satzger, Lehrbuch Strafrecht Allgemeiner Teil, 52. Auflage, 2022
- Zitieren
Das Buch Fischer, Thomas, Kommentar Strafgesetzbuch, 69. Auflage, 2022 kann z. B. im Text wie folgt zitiert werden:
Fischer, a. a. O., § 27 StGB, Rn. 14.
Das Buch Meyer-Goßner/Schmitt, Kommentar Strafprozessordnung, 65. Auflage, 2022 kann z. B. im Text wie folgt zitiert werden:
Schmitt in Meyer-Goßner/Schmitt, a. a. O., § 154a StPO, Rn. 14.
Wichtig ist, dass das Zitat zusammen mit dem Literaturverzeichnis die zitierte Quelle sicher erkennen lässt.
| Wichtig: Zitieren Sie alle Quellen aus denen Sie Ihr Wissen bezogen haben. Wer viel zitiert arbeitet wissenschaftlich! Wer abschreibt ohne zu zitieren, verletzt nicht nur ggf. Urheberrechte, sondern arbeitet schlichtweg nicht wissenschaftlich. Zitieren hebt die Leistung Ihrer Arbeit an. Die Idee mit einem „fremden“ Gedanken zu glänzen, wertet die Arbeit ab. Gute Arbeiten zitieren ALLES! |
- Textbearbeitung
In der Bearbeitung eines strafrechtlichen Themas oder eines strafrechtlichen Falls erfolgt regelmäßig eine sehr tiefe und extrem detaillierte Erörterung von den einschlägigen Themen. Es ist sehr wichtig, hier bei jedem entscheidenden Problem die h. M. (herrschende Meinung in der Literatur) und die Rechtsprechung zu zitieren und sich intensiv mit den jeweiligen Argumenten schriftlich auseinanderzusetzen. Die extrem detaillierte inhaltliche Auseinandersetzung mit juristischen Problemen ist Ihre Kernleistung.
| Um herauszufinden, ob eine Person sich strafbar gemacht hat oder nicht wird untersucht, ob ein bestimmter Lebenssachverhalt einen Straftatbestand eines Strafgesetzes erfüllt. Diese Prüfung nennt man Subsumtion. |
Beispiel:
| Fall: A schlägt B mit der Faust ins Gesicht. Die Nase des B ist gebrochen. |
Es könnte sich bei diesem Lebenssachverhalt um eine Körperverletzung des A an B gemäß § 223 StGB handeln.
- Tatbestand
Jedes Strafgesetz hat einen Tatbestand. Dieser muss erfüllt sein um zu einer Strafbarkeit einer Person zu gelangen.
1.1 Objektiver Tatbestand
1.1.1 Grundtatbestand
Dies ist der objektive Grund-Tatbestand einer Körperverletzung.
| Strafgesetzbuch (StGB) § 223 Körperverletzung (1) Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Der Versuch ist strafbar. |
| StRJ: Die Deutschen Gesetze können Sie kostenlos auf www.gesetze-im-internet.de einsehen und als PDF Dokumente runterladen. |
Definitionen nach Rechtsprechung und Literatur:
Eine körperliche Misshandlung liegt nach der ständigen Rechtsprechung vor, bei einer üblen, unangemessenen Behandlung einer anderen Person, das entweder das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt (Fischer, StGB Kommentar 69. Auflage, 2022, § 223 Rn. 4).
Schädigung an der Gesundheit liegt vor, wenn ein pathologischer Zustand hervorgerufen oder gesteigert wird (Fischer, StGB Kommentar 69. Auflage, 2022, § 223 Rn. 8).
(Subsumtion:)
Durch die Schmerzen die durch den Bruch der Nase hervorgerufen werden sowie durch den schmerzhaften langen Heilungsprozess von mindestens 6 Wochen wird das körperliche Wohlbefinden des B und seine körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt.
Der Nasenbruch stellt auch einen pathologischen Zustand dar.
Durch den Schlag des A auf die Nase des B und die Folge eines Nasenbruchs liegt eine Körperverletzung des § 223 StGB daher unproblematisch vor.
Sie sehen an diesem Beispiel, das man immer zunächst das Gesetz zitiert und mit der entscheidenden Passage im Auszug niederschreibt, dann die Definitionen nach der Rechtsprechung und Literatur zitiert und danach den Fall unter diesen Tatbestand subsumiert. Das hier gewählte Beispiel ist relativ eindeutig. Im Prüfungsfall einer Hausarbeit muss die Darstellung wesentlich tiefer erfolgen. Insbesondere in Steuer- und Wirtschaftsstrafsachen ist die Darstellung sehr umfangreich.
Diese Technik erfolgt für jedes einzelne Tatbestandsmerkmal so detailliert wie möglich.
Bei besonders wichtigen Prüfungspunkten sollten neben der Rechtsprechung und herrschenden Meinung (h.M.) der Literatur auch abweichende Meinungen zitiert werden. Im Anschluss sind die Meinungen gegeneinander abzuwägen und ggf. die eigene Meinung darzustellen.
Am Ende einer jeden Prüfung ist das Ergebnis mitzuteilen.
Bei der Sachbearbeitung eines Themas erscheint es meist sinnvoll am Ende ein „Fazit“ zu ziehen. Dies sollte ebenfalls gründlich formuliert werden. Leider wird dies in der Praxis oft „hinten dran geklatscht“ und reißt die Arbeit oft runter.
Spätestens im letzten Arbeitsgang sind der Hausarbeit Seitenzahlen einzufügen.
Fragen, Anregungen und Hinweise zu diesem Artikel richten Sie bitte an redaktion@strafrechtsjournal.de