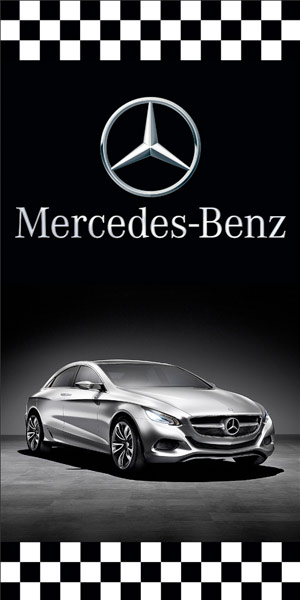Einstellung ohne vollständige Beweisaufnahme – Prozessökonomie gegen Rechtsstaatlichkeit –
Einstellung von der „Vollendung“ auf den „Versuch“ – Umgehung der Beweisaufnahme?
In Strafverfahren mit vielen tausend Geschädigten scheint sich in einigen Prozessen eine gefährliche Tendenz abzuzeichnen. Gerichte neigen dazu, von den Einstellungsparagraphen der §§ 154 und 154a StPO exzessiv Gebrauch zu machen und dies zu Lasten der Angeklagten.
Es geht um Sachverhalte in denen die Täter z. B. bei Investmentangeboten oder dem Zusenden von unberechtigten Rechnungen, die jedoch den Anschein erwecken als seien sie berechtigt, z. B. Arztrechnungen, Registergebühren, Gebühren für Müllentsorgung, GEZ Beiträge oder ähnliches, die „Opfer“ veranlassen eine Zahlung vorzunehmen, obwohl ein Zahlungsanspruch zugunsten der Täter nicht besteht. Hier wird es materiell strafrechtlich zunächst um die Frage gehen, ob bezüglich der Fälle, in denen das Opfer bezahlt hat, ein vollendeter Betrug gemäß § 263 Abs. 1 StGB vorliegt. In den konkreten Fällen wird die Staatsanwaltschaft darüber hinaus meistens dazu neigen, eine Qualifikation nach § 263 Abs. 3 StGB (z.B. Gewerbsmäßigkeit oder Bande) oder § 263 Abs. 5 (z. B. Gewerbsmäßigkeit und Bande) anzunehmen.
Es soll hier jedoch nicht primär Gegenstand dieses Beitrags sein, zu beurteilen, ob im Einzelfall tatsächlich der objektive Tatbestand des § 263 Abs. 1 StGB erfüllt ist. Gegenstand des Beitrags ist die Frage, wie die Gerichte mit der Beweisaufnahme umgehen.
Es scheint die Tendenz zu bestehen, dass Gerichte hier einen „Kunstgriff“ mittels der §§ 154 und 154a StPO vornehmen und dies zu Lasten der Angeklagten. Haben in unserem Beispielsfall mit der Zusendung von unberechtigten Rechnungen 100.000 Kunden bezahlt und die Staatsanwaltschaft hat hiervon 5.000 Fälle angeklagt. Nehmen wir weiter an, dass ein Landgericht bezüglich der 5.000 angeklagten Fälle nur in 30 Fällen Beweis darüber erhoben hat, ob sich die Empfänger der Rechnungen tatsächlich über die Berechtigung der Rechnung geirrt haben und dementsprechend das Landgericht in diesen 30 Fällen wegen vollendetem Betrug verurteilt und im Übrigen die weiteren 4.970 Fälle nach § 154, 154a StPO von der „Vollendung“ auf einen „Versuch“ eingestellt.
Hier stellt sich die Frage, ob eine solche Einstellung rechtmäßig ist oder gegen geltendes Recht verstößt.
Die erste Frage ist, ob die §§ 154, 154a StPO eine Einstellung der „Vollendung“ auf den „Versuch“ vorsehen. Hier soll zunächst ein Blick auf den Gesetzestext Erhellung bringen.
§ 154 StPO sieht die Einstellung einer Tat oder eines Teils von mehreren Taten vor, wenn die Strafe zu der die Verfolgung dieser Tat oder Taten führen kann neben einer anderen Strafe, die gegen den Täter wegen einer anderen Tat verhängt wurde oder noch verhängt werden wird nicht beträchtlich ins Gewicht fällt. Es geht hier thematisch um die Einstellung einer „Tat im Ganzen“. Eine Einstellung der „Vollendung“ einer Tat auf den
„Versuch“ derselben Tat kann hier nicht subsumiert werden, so dass der § 154 StPO für diese Idee des Gerichts nicht herhalten kann.
§ 154a StPO gibt der Staatsanwaltschaft und dem Gericht die Möglichkeit, eine Beschränkung der Strafverfolgung im Rahmen einer Tat vorzunehmen. Es kann die Strafverfolgung für einen „abtrennbaren Teil einer Tat“ oder die Strafverfolgung für „einzelne von mehreren Gesetzesverletzungen“, die durch dieselbe Tat begangen wurden, aufgeben, wenn der „abgetrennte Teil“ oder die „abgetrennte Gesetzesverletzung“ neben der Strafe für den „verbleibenden Teil“ oder „die verbleibende Gesetzesverletzung“ nicht beträchtlich ins Gewicht fällt.
Somit erscheint zunächst bereits äußerst fraglich, ob der 154a StPO überhaupt eine Berechtigung für Einstellung der „Vollendung“ einer Tat auf den „Versuch“ derselben Tat erlaubt. Hierzu vertritt Dr. Bertram Schmitt, Richter am Bundesgerichtshof, in Meyer- Goßner / Schmitt, Kommentar zur StPO, 65. Auflage, 2022, § 154a StPO, Rn. 7a die Auffassung, dass § 154a StPO zwar in diesen Fällen einer Serienbetrugstat eine direkte Anwendung des § 154a StPO verbietet, aber eine „analoge“ Anwendung gerechtfertigt sei.
Des Weiteren erscheint fraglich, ob für die 5.000 angeklagten Fällte auf „Tateinheit“ erkannt werden darf, mit dem tieferen Grund des Gerichts den Weg für eine Einstellung nach § 154a StPO der „Vollendung“ einer Tat auf den „Versuch“ freizumachen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass das Gericht nur deshalb von einer Tateinheit ausgeht, um die gewünschte Einstellung begründen zu können. Anderenfalls bei Annahme einer Tatmehrheit wäre lediglich der Weg über § 154 StPO eröffnet mit der Folge, dass dieser Paragraph auf keinen Fall die Einstellung von der „Vollendung“ einer Tat auf den „Versuch“ rechtfertigt. Mit dieser Idee des Gerichts wird bereits die Rechtsfigur der Tateinheit – in der Regel von der Verteidigung als für den Angeklagten vermeintlich vorteilhaft angestrebt – in sein Gegenteil verkehrt und dient lediglich als „Sprungbrett“ in die weitere Dehnung des Rechts jetzt in den vermeintlichen Anwendungsbereich des § 154a StPO zu kommen und diesen ebenfalls in sein Gegenteil zu verkehren um zu Lasten des Angeklagten auf eine Beweisaufnahme in über 99 % der angeklagten Fälle zu verzichten.
Die „überrumpelte“ Verteidigung wird in diesen Fällen mit der „Einstellung“ von der „Vollendung“ auf den „Versuch“ geködert in der Hoffnung, dass der Angeklagte in den Genuss der fakultativen Strafmilderung nach § 49 StGB kommt. Frei nach dem Motto „Einstellung ist immer gut“ stimmt der eine oder andere Verteidiger dieser „Einstellung“ von der „Vollendung auf den Versuch“ zu, ohne zu merken, dass das Gericht die Einstellungsparagraphen nach §§ 154, 154a StPO zu Lasten des Angeklagten missbraucht um sich eine weitere Beweisaufnahme zu ersparen.
Es stellt sich daher die weitere Frage, ob eine „Einstellung“ von der „Vollendung auf den Versuch“ gegen § 244 Abs. 2 StPO (Amtsaufklärungspflicht) verstößt. Zu dieser Prüfung gelangt der Rechtsanwender jedoch nur dann, wenn sie oder er im ersten Prüfungsschritt zu der Auffassung gelangen sollte, dass in 5.000 Fällen eine Tateinheit vorliegen kann und der § 154a StPO eine „Einstellung“ von der „Vollendung auf den Versuch“ legitimieren kann.
Eine Einstellung nach §§ 154, 154a StPO dient der Prozessökonomie. Dieses Ansinnen ist verständlich und grundsätzlich sinnvoll. Es stellt sich allerdings die Frage, in welchem Verhältnis das Bestreben nach „Prozessökonomie“ zu dem rechtsstaatlichen Grundsatz der „vollständigen Erforschung des Sachverhalts“ nach § 244 Abs. 2 StPO und damit der Rechtsstaatlichkeit und dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs (§ 103 Abs. 1 GG, Art. 6 Abs. 3, lit d) EMRK) steht.
Ist es zulässig, nach den §§ 154, 154a StPO mehr als 99 % der Fälle von der „Vollendung“ auf eine „Versuchsstrafbarkeit“ „einzustellen und damit die Beweisaufnahme zu umgehen?
In dem Berichtsfall kam noch hinzu, dass das Landgericht einen Beweisantrag der Verteidigung auf Vernehmung von vier Entlastungszeugen mit Hinweis auf § 244 Abs. 3, Satz 2 StPO wegen „Offenkundigkeit“ abgelehnt hat, weil die Tatsache (hier: Irrtumserregung) schon erwiesen gewesen sein soll. Faktisch hat das Landgericht damit die Beweisaufnahme zu 99,4 % gar nicht durchgeführt und für die restlichen 0,6 % nur Zeugen der Staatsanwaltschaft vernommen. Es fällt hier schwer noch von einem „fairen Verfahren“ zu sprechen.
Unabhängig von dieser weiteren Besonderheit des Berichtsfalls stellt sich jedoch generell die Frage in welchem Verhältnis der Grundsatz der „Prozessökonomie“ auf der einen Seite und der Grundsatz der „Erforschung des Sachverhalts“ auf der anderen Seite stehen.
Der BGH (BGH 1 StR 263/12) führte hier in einem ähnlichen Fall folgendes aus:
Die vom LG mit dem Begriff der „Prozessökonomie“ beschriebene Notwendigkeit, die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege zu erhalten besteht. Jedoch muss ein Tatgericht im Rahmen der Beweisaufnahme die in der Strafprozessordnung dafür bereit gehaltenen Wege beschreiten. Ein solcher Weg ist etwa die Beschränkung des Verfahrensstoffs gem. §§ 154, 154 a StPO, die allerdings die Mitwirkung der StA voraussetzen. Eine einseitige Beschränkung der Strafverfolgung auf bloßen Tatversuch ohne Zustimmung der StA, wie sie das LG hier – freilich im Rahmen gleichartiger Tateinheit mit vollendeten Delikten – vorgenommen hat, sieht die StPO jedoch nicht vor.
Es trifft allerdings zu, dass in Fällen eines hohen Gesamtschadens, der sich aus einer sehr großen Anzahl von Kleinschäden zusammensetzt, die Möglichkeiten einer sinnvollen Verfahrensbeschränkung eingeschränkt sind. Denn dann sind keine Taten mit höheren Einzelschäden vorhanden, auf die das Verfahren sinnvoll beschränkt werden könnte.
Dies bedeutet aber nicht, dass es einem Gericht deshalb – um überhaupt in angemessener Zeit zu einem Verfahrensabschluss gelangen zu können – ohne Weiteres erlaubt wäre, die Beweiserhebung über den Taterfolg zu unterlassen und lediglich wegen Versuchs zu verurteilen. Vielmehr hat das Tatgericht die von der Anklage umfasste prozessuale Tat (§ 264 StPO)
im Rahmen seiner gerichtlichen Kognitionspflicht nach den für die Beweisaufnahme geltenden Regeln der Strafprozessordnung aufzuklären. Es kann daher ein Verstoß gegen § 244 Abs. 2 StPO (Amtsaufklärungspflicht) vorliegen.
Die richterliche Amtsaufklärungspflicht nach § 244 Abs. 2 StPO gebietet dabei, zur Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind.
Da der Betrugstatbestand voraussetzt, dass die Vermögensverfügung durch den Irrtum des Getäuschten veranlasst worden ist, müssen die Urteilsgründe regelmäßig darlegen, wer die Verfügung getroffen hat und welche Vorstellungen er dabei hatte. Die Überzeugung des Gerichts, dass der Verfügende einem Irrtum erlegen ist, wird dabei in der Regel dessen Vernehmung erfordern. Ist die Beweisaufnahme auf eine Vielzahl Geschädigter zu erstrecken, besteht zudem die Möglichkeit, bereits im Ermittlungsverfahren durch Fragebögen zu ermitteln, aus welchen Gründen die Leistenden die ihr Vermögen schädigende Verfügung vorgenommen haben.
Das Ergebnis dieser Erhebung kann dann – etwa nach Maßgabe des § 251 StPO – in die Hauptverhandlung eingeführt werden. Hierauf kann dann auch die Überzeugung des Gerichts gestützt werden, ob und gegebenenfalls in welchen Fällen die Leistenden eine Vermögensverfügung irrtumsbedingt vorgenommen haben.
Welche Schlussfolgerungen ergeben sich hieraus?
Die Auffassung, dass § 154a StPO in den Fällen einer Serienbetrugstat eine direkte Anwendung des § 154a StPO verbietet, aber eine „analoge“ Anwendung rechtfertigt mit der Folge, dass eine Einstellung von der „Vollendung“ auf den „Versuch“ in einer überwiegenden Zahl von angeklagten Fällen möglich sei, vermag ohne weitere Einschränkungen nicht zu verfangen. Um der Rechtsstaatlichkeit Genüge zu tun, bietet es sich an, dass das erkennende Gericht in mindestens 50 % der angeklagten Fälle eine Beweisaufnahme durchführt um die „restlichen“ Fälle ohne Beweisaufnahme im Versuch verurteilen zu können. Die Staatsanwaltschaft kann insoweit Hilfe leisten als sie die Zahl der angeklagten Fälle reduziert. Auf die letztlich ausgeurteilte Strafe wird die Auswirkung in diesen „Massenfällen“ ohnehin gering sein. Letztlich kommt es auch auf die Details der angeklagten Betrugsfälle an; insbesondere auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschädigten in gleicher Weise tatsächlich getäuscht wurden. Entscheidend ist, dass nicht von einigen wenigen Zeugen auf sämtliche Geschädigte geschlossen wird, wenn es Zweifel daran gibt, dass sich sämtliche Zeugen in gleicher Weise getäuscht haben sollen. Diese Zweifel bestanden zum Beispiel bei den sog. Fällen der „Schlüsseldienstmafia“.
Bitte senden Sie uns Ihre Meinung an meinung@strafrechtsjournal.de